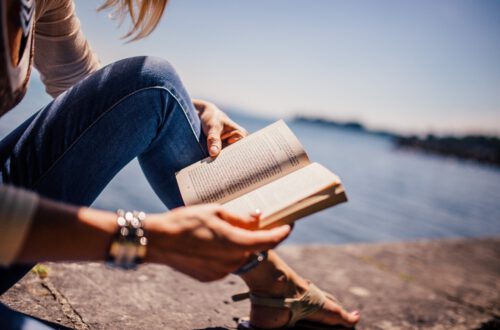Die großen Könige
Werfen wir einen Blick in die Geschichtsbücher stechen uns vor allen zwei Könige herausragend ins Auge. Zum einen in Film und Fernsehen der oft als egozentrisch und narzisstisch dargestellte französische Sonnenkönig Ludwig XIV.. Zum anderen der introvertierte und philosophische Preußische König Friedrich II. auch der Alte Fritz genannt.
Jugendliche impulsive Punksucht stehen hier reservierten, konservativen Reformdenken gegenüber. So wie sich die Könige in ihrem Wesen unterscheiden, unterscheiden sich auch ihre Darstellungen. Doch woran liegt das?
Bildung und das Erlernen von Lesen und Schreiben war im 18. Jahrhundert nur Adligen und / oder Geistlichen vorbehalten. Die Bildnisse der Könige dienten vor allen der Visualisierung der besonderen übermenschlichen Position des Königs und dessen Macht über seine ihm unterstellten Untertanen. Des Weiteren dienten sie nach deren Ableben als Erinnerungsbilder in der Ahnengalerie, als Objekt der Nachahmung und als Legitimation der königlichen Erbfolge.
Anfang des 18. Jahrhunderts, zeigen Herrscherbildnisse den König im monumentalen oder mindestens lebensgroßen Format. Angelehnt, Stehend oder auf dem Thron sitzend. Bevorzug vor allem als tapferer Feldherr oder im Reiterporträt. Sie erinnerten in ihren Posen stark an die alten römischen Kriegsherren.
Man darf nicht vergessen, dass hier bewusst ein bestimmtes Image gepflegt wird. Es handelt sich um Auftragsarbeiten. Hierfür wurden eigens Hofmaler eingestellt, die im Auftrag des Herrschers unter dessen Vorstellungen und Richtlinien Werke schuf.
Zu den Bestandteilen der Herrscherbildnisse gehörte die wohldurchdachte Auswahl von Attributen und Insignien. Zu den beliebtesten gehörten unter anderen Rüstung, Zepter, Schwert und der Hermelinmantel. Diese befanden sich in unmittelbarer Nähe des Königs und sollten unter anderen seine außergewöhnliche Tugendhaftigkeit, sein starkes Durchsetzungsvermögen, sein Tapferkeit und seine Überlegenheit unterstreichen.
Ludwig XVI. (1638 – 1715) charakterisierte sich als „König von Gottes Gnaden“ und ließ sich so auch 1701 von Hyacinthe Rigaud darstellen. Das Bild zeigte ihn als unantastbaren alleinigen Herrscher. Er ist umringt von zahlreichen Kostbarkeiten die auf seine exzellenten inneren Werte und grandiosen Verstand verwiesen. Damit setzte er einen neuen Trend.
Hierbei ist zu erwähnen, dass es sich um eine idealisierte, also makellos verschönerte Darstellung des Königs handelt. Auf individuelle Gesichtszüge wurde verzichtet. Den bereits über sechzig Jährigen König ziert keine Altersfalte sondern erstrahlt in voller Jugendlichkeit. Ludwig XIV. war der erste der sich als Herrscher mit zahlreichen christlichen Symbolen und Attributen in einer äußerst prachtvollen und detaillierten Bildkomposition darstellen ließ und wurde zum internationalen Vorbild aller Königshäuser. Aufgrund seiner langen siebzig jährigen Regentschaft saß er für zahlreiche Porträts Modell.
Im Gegensatz dazu konnte sich Friedrich II. von Preußen (1712- 1786) nur zwei Mal dazu durchringen seinen Hofmaler Modell zu sitzen. Er galt als äußerst wissbiergieriger und aufgeklärter König. Er sah sich selbst als erster Diener im Staate und förderte unter andere anderem das Schulwesen. Dadurch stieg das Bildungsniveau seines Volkes. Der Gedanke der Zeit seinen eigenen Verstand zu nutzen beeinflusste auch die Ausrichtung und das Wesen der Kunst.
Das Bekannteste Herrscherbild Friedrichs II. ist ein ins Oval verkleinerte Brustbild von 1781, dass durch sein Format und seine Größe keine Möglichkeiten mehr gibt, eine prachtvolle ausgeschaltete Architektur, Landschaft, Attribute oder Insignien einzufügen.
Der Fokus liegt einzig und alleine auf die Individuellen Gesichtszüge des Königs von Preußen und entsprach vollkommen dem Zeitgeist der Aufklärung. Seine Person und nicht das Amt des Königs steht im Vordergrund der Betrachtung. Der Maler Anton Graff legte großen Wert auf die naturgetreue Wiedergabe von Mimik und Gestik des Gesichtes Friedrichs des Großen. Orden und uniform gehörten zu dieser Zeit zur Alltagskleidung.
Anhand der wirklichkeitsgetreuen Abbildungen kann auf den Charakter und die Seele des Porträtierten zurück geschlossen werden.
In Preußen stellt das Ende des 18. Jahrhunderts, durch seine weitreichenden politischen und sozialen Reformen, einen tiefreichenden kulturellen Wandels des Selbstverständnisses und der Individualität da.
Es besteht also ein Starker Kontrast zwischen den detailreichen prunkvoll aufgeladenen absolutistischen französischen Herrscherporträt“ Ludwig XIV.“, welches Anfang des 18. Jahrhunderts geschaffen wurde.
Eine solche Darstellung entspricht nicht mehr den Zeitgeist indem Fortschritt und Wissenschaft zunehmend Einfluss in das alltägliche Leben nehmen.
Der Wandel von einem monumentalen Repräsentationsbild hin zu einem Staatsporträt im bürgerlichen Typus ist somit auf einen Wandel gesellschaftlicher Strukturen und unterschiedlicher Selbstverständnisse zweier unterschiedlicher Epochen zurück zu führen.
Bilder müssen immer in ihrem jeweiligen geschichtlichen Kontext eingeordnet werden. Ludwig XIV. wollte vor allem all herrlicher reicher, von Gottes Gnaden autorisierter Alleinherrscher, durch Vorführung seines Reichtums gesehen werden. Nach seinem Ideal sollten sich die Menschen ausrichten.
In der Zeit der Dichter und Denker, wollte Friedrich II. wollte vor allem durch seine Taten im Reich von seinen Volk und seiner Nachweilt in Erinnerung bleiben.
*Bildmaterial
Fred Licht: Goya. Die Geburt der Moderne, München: Hirmer 2001 Seite 110
Fehlmann, Mare / Verwiebe Brigit ,(Hrsg.): Anton Graff: Gesichter einer Epoche: [anlässlich der Ausstellung „Anton Graff. Gesichter eine Epoche“, 22 Juni- 29. September 2013], Ak, Hirmer Verlag München, 2013 Seite 129